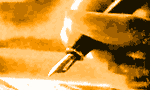| Salonfourm
für Besucher |
Salon im Net, den
06. September 2004
ein Online Projekt
von Ilona Duerkop
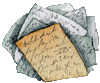
|

|

|

|

|

|

|
Einmal im Monat, wenn der Wächter frühmorgens die Gittertüren aufgeschlossen hat, betritt ein elegant gekleideter älterer
Herr die kleine Passage Verdeau im 9. Pariser Arrondissement. Noch liegt die altmodische Ladenstraße in tiefem Schlaf.
Hoch unter dem Gewächshausdach hallen die Schritte auf dem blank gescheuerten Steinfußboden wider. Mit ihren schmiedeeisernen
Straßenlaternen und der geschmückten Wanduhr wirkt die Passage selbst wie eine kostbare Vitrine. Der Herr ist der Eigentümer
des Ladens Nr. 9, in dessen Schaufenster Kunst- und Ausstellungsplakate hängen. Er schließt seine Glastür auf, holt Putzmittel
heraus und reinigt liebevoll die große Glasfront, die filigranen Metallrahmen und die Türschwelle. Nach einer guten Stunde verschließt
er sein Geschäft wieder, prüft noch einmal mit Genugtuung die ganze Pracht und geht fort.
Sammeln, so heißt es, ist praktisches Erinnern. Und kaum ein Ort ist dafür geeigneter als die Passage Verdeau, die 1847
von einer Aktiengesellschaft errichtet wurde, aber längst in Einzeleigentum parzelliert ist. Ihre Besitzverhältnisse datieren
auf Zeiten zurück, die keiner der heutigen Passagenbewohner mehr kennt. Auch die Concierge, deren Remise von der Passage
abzweigt, kann uns nicht weiterhelfen: »Sie müssen so lange wiederkommen, bis Sie den Herrn irgendwann einmal treffen.«
Es sind nur knapp 100 Schritte, die die Passage Verdeau zwischen ihren beiden Eingängen an der Rue Faubourg Montmartre
und der Rue de la Grange Batelière misst. Sie ist eines der ruhigsten und unspektakulärsten Exemplare dieser weltberühmten
städtischen Höhlengänge, durch deren Glasdächer das Licht sommers wie winters wie weißer Staub fällt. Ein durchlaufendes
Röhrensys-tem führt von der Passage Verdeau in die Passage Jouffroy und die Passage des Panoramas. Die Bewohner des
Quartier Drouot, das seinen Namen vom ältesten Kunst- und Auktionshaus der Welt nebenan hat, durchqueren die Verdeau
in einer Minute, weil sie der kürzeste Weg zwischen der École Maternelle am unteren Ende und den Lebensmittelgeschäften
in der Rue Cadet auf der anderen Seite ist. Touristen verweilen etwas länger vor den wertvollen alten Holzkameras im Schaufenster
von Photo Verdeau, den Stickereien von Bonheur des dames oder den Auslagen der Antiquare. Ausdauernder sind nur die
Liebhaber und Sammler, die im Cabinet des Curieux die Neueingänge an asiatischen Dolchen, afrikanischen Masken oder
Grabbeigaben aus aufgelassenen Friedhöfen studieren.
Obwohl wir vor gut einem Jahr ins Quartier Drouot gezogen sind und seitdem alle Geschwindigkeiten der Passage ausprobiert
haben – die täglichen Besorgungsgänge, die kleinen Promenaden an verregneten Wochenenden und die ausgedehnten Besuche
bei den Antiquaren –, haben wir es bislang nicht geschafft, das Tempo des Sonderlings vom Laden Nr. 9 zu erreichen. Immer
waren wir entweder zu früh oder zu spät, um dem Herrn zu begegnen. Einmal, es war kurz vor Weihnachten, müssen wir ihn
um Minuten verpasst haben, da auf den Steinplatten vor seinem Laden noch kleine Wasserlachen standen, die von dem frischen
Reinigungswerk kündigten.
»Es gibt weniges in der Geschichte der Menschheit, über das wir soviel wissen wie über die Geschichte der Stadt Paris«,
notierte Walter Benjamin in den dreißiger Jahren. Bereits der Katalog der kaiserlichen Bibliothek, der unter NapoleonIII. herauskam,
enthielt unter dem Stichwort Paris über 100 Seiten, und darin war nur ein Bruchteil der Sonderliteratur enthalten, die es über jede
Straße, jedes Bauwerk und auch jede Passage gab. Und obwohl seitdem die Paris-Literatur ins Unermessliche gewachsen ist und
jeder Pflasterstein der Hauptstadt von allen Seiten untersucht und beschrieben sein dürfte, kann man mit Gewissheit annehmen:
Derjenige, dem es gelänge, das seit einem Vierteljahrhundert währende Geheimnis des Eigentümers von Nr. 9 zu lüften, könnte
in dieses aufgeschlagene Riesenbuch der Zivilisationsgeschichte sicherlich eine neue und aufschlussreiche Episode einschreiben.
Passer, passé, passager: vorübergehen, vergangen, flüchtig – auf die über 100 Pariser Passagen, die in den vergangenen
200 Jahren gebaut und wieder abgerissen wurden, mag dieser Wortstamm in banalem Sinne zutreffen, eben weil sie verschwunden
sind. Aber die 16 bis heute erhaltenen Exemplare, die sich auf wenigen Quadratkilometern im Halbkreis der Grands Boulevards am
nördlichen Seine-Ufer ballen, zeigen im Gegenteil eine geradezu monumentale Dauerhaftigkeit, in der die Menschen kommen und
gehen, aber das Rätsel der Zeitlosigkeit bleibt. Es ist fast gespenstisch, wie aktuell sich Walter Benjamins Passagen-Werk heute
noch liest, jene Urgeschichte der Moderne, die der Berliner Philosoph aus Tausenden von Briefen, Chroniken, Romanen,
Reiseführern und Zeitungsartikeln aus dem Paris des 19. Jahrhunderts konstruiert hatte.
Benjamin deutete wie Freud die Stadt Paris und ihre Literatur als Traumtexte und verstand dabei die Passage in psychoanalytischem
Sinn als Durchbruch durch die Oberfläche, als Einschnitt in die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Er ging sogar so weit,
das Häuserlabyrinth der Städte mit dem wachen Bewusstsein zu vergleichen, aus dem heraus die Passagen in die Traumwelt des
Unbewussten führen: »Passagen sind Häuser oder Gänge, welche keine Außenseite haben – wie der Traum.« In diesen glasüberwölbten
Treibhäusern konnten die zentralen Techniken und Begierden der Moderne – Gasbeleuchtung, Eisenkonstruktion, Massenmedien, Mode,
Reklame und die gesamte Warenästhetik – ihrer industriellen Massenfertigung entgegenreifen.
Während Straßen üblicherweise dem Handel und dem Verkehr dienen, lässt das Schritttempo einer Passage den Verkehr ins Stocken
geraten, sodass die Waren genug Zeit haben, an den Wänden emporzuwachsen – was die Passanten zusätzlich daran hindert, schnell
vorwärts zu kommen. Um das andere Tempo in einer Passage zu erfahren, muss man gar nicht an die Dandys erinnern, die zu Beginn
des 19. Jahrhunderts ihre Schildkröten an einer Leine spazieren führten. Beim Gang durch die Passagen Verdeau, Jouffroy und Panoramas
genügt es, immer wieder einen Laden zu betreten und die Inhaber in ein Gespräch zu verwickeln.
Die »in meergrünes Licht getauchten Menschenaquarien«, wie Louis Aragon die Passagen 1926 in seinem Pariser Landleben nannte,
sind bis heute vornehme Langschläfer: Ihre Läden öffnen um elf Uhr oder noch später und sind erst zur Mittagspause richtig erwacht,
wenn die Büroangestellten des Pariser Banken- und Börsenviertels zum Dejeuner ausschwärmen. Doch selbst in den Stoßzeiten
verlieren diese Wandelgänge – fernab vom reißenden Strom des Massensortiments – nichts von ihrer gelösten Ruhe und wohltuenden Friedfertigkeit.
In der Jouffroy gibt es den gut sortierten marokkanischen Soukh Palais Oriental, der sich im Lauf der Jahre hinterrücks bis zu einem
zweiten Eingang auf den Boulevard Montmartre durchgebohrt hat, dazu Kabinette für Muscheln und Mineralien und daneben die
Kunstbuchhandlung von Paul Vulin.
Mit seinen geschickt in den Passagengang eingebauten Bibliotheksschränken erzeugt der Laden die Illusion, die ganze Flanke
gehöre zum Interieur der Bücherei. Ein perfekter Theatereindruck ergibt sich aus der Perspektive der Fensterreihen im Obergeschoss
der Pâtisserie La tour des délices oder im Friseursalon von Nelly Chaubet. Von hier oben aus kann man, wie von einer Theaterloge herab,
in die Bühne der Passage hinein, aber nicht umgekehrt aus der Szene herausschauen.
Im Miniaturkaufhaus ist alles auf den Maßstab 1:20 geschrumpft
Seit drei Jahrzehnten betreiben die Brüder Segas in der Passage Jouffroy ihr Fachgeschäft für Spazierstöcke. »Wir sind die Einzigen
auf diesem Planeten, die sich restlos auf Spazierstöcke spezialisiert haben«, sagt Gilbert Segas, 70, ein glatzköpfiger Hüne mit
mächtigem Schnauzer. Er ist Spross einer Schauspielerfamilie aus Rouen, hat selbst lange Theater gespielt und dabei auch
Bühnendekorationen und Requisiten gebaut, bis er sich schließlich auf den Spazierstock konzentrierte. Im Schaufenster hat
er die preiswerteren Exemplare à 100 Euro für die Laufkundschaft wie Blumengebinde gruppiert, wichtigere Kunden lässt er
im Oberschoss in tiefen Lederfauteuils versinken, vor denen er dann seine Schatztruhen öffnet: spanische Fabrikate aus
reinem Schildpatt mit graviertem Silberknauf für 8000 Euro, ein reich verziertes Ebenholzrohr von der Dicke eines Kleinkinderarmes,
das sich wie ein Patentmöbel mit wenigen Handgriffen in eine ausgewachsene Malerstaffelei auseinander falten lässt, für 14000 Euro.
»Uns reichen zwei bis drei gute Kunden im Monat«, sagt Segas. Seine Abnehmer sind Sammler, die mit den Stöcken alles
andere im Sinn haben als ihre krude Nutzanwendung. »Ein guter Gehstock«, doziert der Händler und schwingt seine mit
Jade- und Elfenbeinköpfen geschmückten Prachtstücke wie Tambourstäbe, »ist nicht dafür gemacht, den Boden zu berühren.«
Gegenüber von Segas liegt das Spielwarengeschäft Pain d’Épices von Françoise Blindermann, 56, das streng genommen
ebenfalls zu den Sammlergeschäften zählt. Bei diesem Paradiesgarten für handgefertigte Puppen, Bären, Miniaturhäuser,
Blechfiguren, Baukästen und Bastelbedarf handelt es sich in Wahrheit um ein kleines grand magasin, ein ausgewachsenes
Miniatur-Warenhaus auf 150 Quadratmetern, in dem alle Gebrauchsgegenstände auf den Maßstab 1:20 geschrumpft sind.
Die charmante blonde Inhaberin, die vor allem deutsche Fabrikate liebt, hat vor 32 Jahren das Geschäft von ihrer Mutter
übernommen und es seitdem um zwei Nachbarläden erweitert. Dass sie viele der Traditionsspielwaren als Sammlerobjekte
deklarieren muss, liegt an den heutigen Sicherheitsvorschriften – wegen der Verletzungsgefahr für Kinder.
»Eine Passage«, sagt Françoise Blindermann, »lebt davon, Dinge anzubieten, die es in den Supermärkten am Stadtrand
nicht gibt.« Als sie 1972 ihr Geschäft eröffnete, war die Jouffroy mit Ramschläden, Copyshops und Reisebüros auf dem
Tiefpunkt ihrer Geschichte angelangt und diente sogar als Umschlagplatz für Drogen, weil die Dealer ihre Ware leicht in
den Bücherkästen der Bibliothekare verstecken konnten. Erst seitdem das Ensemble vor 20 Jahren unter Denkmalschutz
gestellt und sorgfältig renoviert wurde, hat sich das Durchhaltevermögen der Traditionsgeschäfte ausgezahlt und neue
Detailhändler angezogen, die die Passage Jouffroy zu einer der angenehmsten Galerien in Paris gemacht haben.
Das lässt sich von der 1799 eröffneten Passage des Panoramas, die südlich des Boulevard Montmartre anschließt, nicht sagen.
Dort hat sich in zerschlissenem Ambiente auf notdürftig geflicktem Mosaikboden eine Monokultur aus Philatelie- und
Postkartengeschäften angesiedelt, von denen sich die letzten Landmarken umso deutlicher abheben: die Graveursfamilie
Stern, die dort seit 1840 in fünfter Generation ihr mit goldenem Córdoba-Leder ausgeschlagenes Luxuskontor betreibt,
daneben das wie aus lasiertem Marzipan modellierte Interieur der längst verflossenen Schokoladenhandlung von François Marquis,
das sich in ein neues Restaurant hinübergerettet hat, und der Künstlereingang zum benachbarten Théâtre des Variétés, den
schon Zolas Kokotte Nana benutzt hat. Doch an ihrem hinteren Ende, an dem die Passage des Panoramas wie ein Flussdelta
in mehrere Seitenarme zerfließt, hat sich zunehmend Treibgut angesammelt: asiatische Garküchen, Schnellimbisse und ganz
zum Schluss die Schwulensauna Euro men’s club, die mit ihrer strengen Einlasskontrolle unter Ausschluss der allgemeinen
Öffentlichkeit arbeitet.
So kehrt man lieber in die Passage Jouffroy zurück, wo sich das Hôtel Chopin seit 1847 im Zentrum der Galerie versteckt.
Mit seinen 37 winzigen Zimmern zählt es zu den ruhigsten Orten, die in Paris zu finden sind. Monsieur Bidal, 53, Sohn eines
Steinbruchbesitzers aus der Bourgogne, hatte vor zwölf Jahren seinen Familienbetrieb verkauft und aus dem Erlös des damals
noch Hôtel des familles genannte Kleinod erworben. Absichtlich ließ er es nur auf Zwei-Sterne-Standard renovieren, weshalb
es seit Jahren ständig ausgebucht ist. Er könnte mit höherem Standard leicht das Doppelte einnehmen, sagt der Eigentümer,
aber er ziehe es vor, dass die Belegung auch dann hoch bleibe, wenn schlechtere Zeiten kämen.
In dem bienenwabenartig verwinkelten Hotel, in dessen Hohlräume sich die benachbarten Etagen des 1882 eröffneten
Wachsfigurenkabinetts Musée Grévin geschoben haben, hängen auf gepflegten Seidentapeten reizende Landschaften,
gemalt von Großmutter Bidal, die mit dem Ausblick der Zimmer auf das lang gestreckte Glasdach der Passage konkurrieren.
Und plötzlich erkennt man von hier oben aus, dass eine Passage weniger ein Höhlengang, sondern vielmehr eine Brücke ist,
die durch das Labyrinth der Innenhöfe schwebt.
Trockenen Fußes durch Häuserschluchten
In der Tat geht die erste Passage am Garten des Palais Royal auf das Jahr 1786 zurück, als die dicht bebauten und bewohnten
Brücken über der Seine aus Sicherheitsgründen verboten und abgerissen wurden. Damals zogen die vertriebenen Kaufleute in
die Arkaden des Palais Royal und die neuen Wandelgänge um. So tragen Passagen, weil sie trockenen Fußes durch
Häuserschluchten führen, die Erinnerung an ihren Ursprung immer noch mit sich. Als Brücken über den Fluss der Zeit
sind die Pariser Passagen zu städtischen Versammlungsräumen geworden, wo sich Gebrauchsgegenstände in
Sammelobjekte verwandeln und wo sich das flüchtige Gedächtnis der Passanten an dauerhafte Erinnerungsorte bindet.
Ihr schönstes Denkmal haben sie in der leeren Wunderkammer der Passage Verdeau Nr. 9 gefunden.
Information
Unterkunft: In der Passage Jouffroy: Hôtel Chopin, zwei Sterne, 37 Zimmer zwischen rund 70 und 90 Euro, Tel. 0033-1/47705810
Hôtel Ronceray, vier Sterne, 130 Zimmer zwischen 139 Euro und 244 Euro, Tel. 0033-1/42 47 13 45
Passagen: Die drei zusammenhängenden Passagen Verdeau, Jouffroy und Panoramas (eröffnet zwischen 1799 und 1847)
sind alle vom Boulevard Montmartre aus zu erreichen
Zu den schönsten der heute noch erhaltenen 16 Pariser Galerien gehören die Passage Véro-Dodat, eröffnet 1826, 2, Rue de Bouloi, 1.
Arrondissement, glasüberdacht, Wandmalereien
Passage Choiseul, eröffnet 1827, 44, Rue de Petits-Champs, 2. Arrondissement, insgesamt weniger prachtvoll, dafür schöne Details
wie Jugendstilfenster und Bogenkonstruktionen
Galerie Vivienne und Colbert, eröffnet 1826, 4, Rue de Petits-Champs, 2. Arrondissement, architektonische Meisterwerke mit
Mosaikfußböden und im Empire-Stil verzierten Bogenkonstruktionen. Mächtige Glaskuppel, Holzschnitzereien, Wandgemälde in der Galerie Colbert
Literatur: Die beste historische Übersicht bietet Johann Friedrich Geist: »Passagen, ein Bautyp des 19. Jahrhunderts«, Prestel-Verlag,
München 1979 (nur noch antiquarisch erhältlich)
Der beste praktische Stadtführer: Patrice de Moncan: »Les passages couverts de Paris«, Editions du Mécène, Paris 2001, 304 S.,
17,39 Euro über www.alapage.com oder www.amazon.fr
Walter Benjamin: »Das Passagenwerk«, zwei Bände, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1983; 1354 S., 25,60 Euro.
Hans Scherer: »Pariser Passagen«, Schöffling & Co., Frankfurt am Main 1996; 130 S., 14,50 Euro. »Paris«, Kunstreiseführer,
DuMont Reiseverlag, Köln 2003; 400 S., 12,90 Euro
Auskunft: Französisches Fremdenverkehrsamt Maison de la France, Westendstraße 47, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/97580121, www.franceguide.com
Paris
Das Geheimnis der Nr. 9
Die Passagen von Paris sind Brücken über den Fluss der Zeit.
Sie führen von einem seltsamen Erinnerungsort zum nächsten
Von Michael Mönninger
Sein Laden ist nie geöffnet, er verkauft nichts. Passanten müssen schon eine Weile durch die Lücken zwischen den Plakaten spähen,
bis sich ihre Augen an das pechschwarze Interieur gewöhnt haben. Schemenhaft zeichnen sich dann einige leere Regale und ein
paar Stühle ab. Die Wunderkammer ist leer.
Das geht so seit 25 Jahren, sagt die Barfrau im Bistro nebenan. Der Wirt pflichtet ihr bei: Niemand kenne den Namen des
Eigentümers, kein Kunde sei jemals dort gewesen, trotzdem sei der Laden weder zu verkaufen noch zu vermieten. Der
Antiquitätenhändler vom Cabinet des Curieux gegenüber vermutet, dass es sich um jemanden handelt, der seinen über
Generationen vererbten Familienbesitz wie eine Trophäe pflegt, ohne daraus Nutzen ziehen zu wollen. Einfach ein Stück
Raum im Wandel der Zeit, ein Laden, der wie ein Sammelobjekt der Verwertung entzogen ist, ein Wirtschaftsgut, das keinen
Warencharakter mehr hat, sondern nur noch Selbstwert.
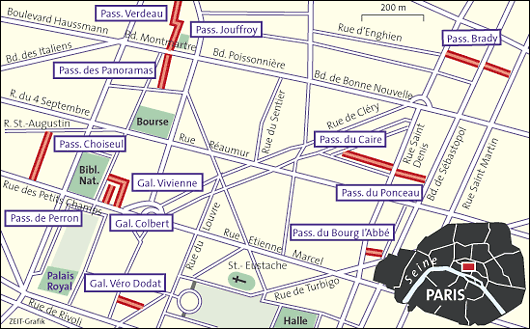
© Michael Mönninger
Wenn Sie mir etwas schreiben möchten, klicken Sie auf die Grafik.